Ihr Lieben, es gibt Themen, die gehen uns leichter von den Lippen als andere, die Erfahrung werdet ihr als Eltern auch schon gemacht haben. Aber wie spreche ich mit meinem Kind über Sterben, Trauern und den Tod? Wie über Sexualität, Doktorspiele und Grenzen, wie über Wahrheit, Freundschaft oder Geld?
Familienberaterin und Bestsellerautorin Nicola Schmidt vom artgerecht Projekt begleitet in ihrem neuen Buch „Zehn wirklich wichtige Gespräche, die Kinder und Eltern wachsen lassen: Liebe, Lügen, Tod und Grenzen – Wie wir bei schwierigen Themen die richtigen Worte finden“ Eltern durch zehn zentrale Gespräche, die ihren Kindern Sicherheit geben – und die uns Eltern oft sprachlos machen.
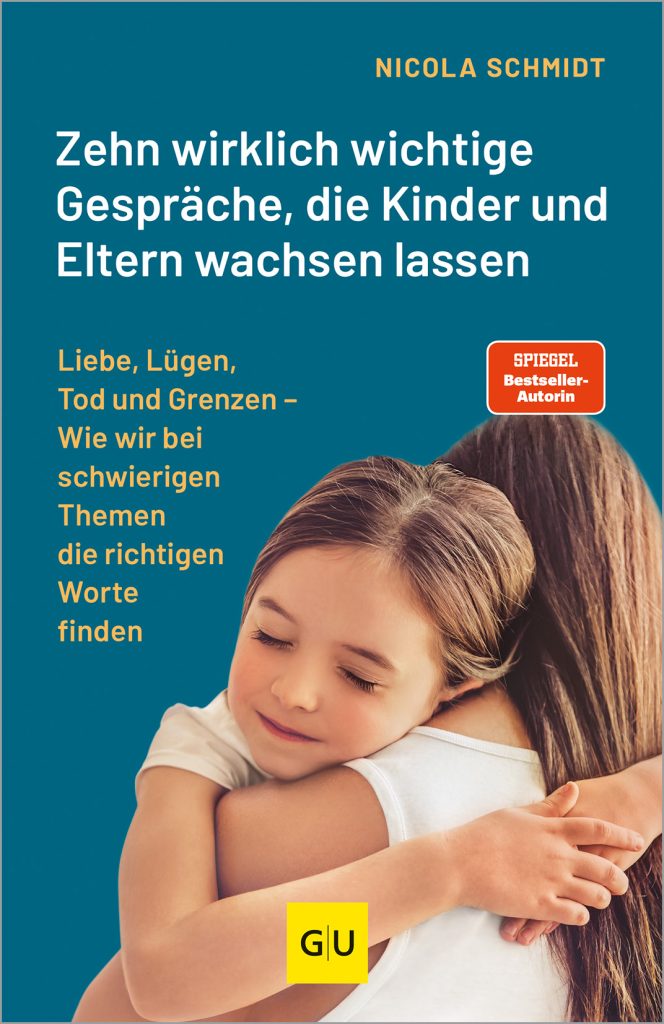
Von den ersten Worten im Säuglingsalter über die Herausforderung, Kindern Empathie und Toleranz nahezubringen. Viele dieser Gespräche sind Eltern unangenehm oder sie wissen schlicht nicht, wie sie es anfangen sollen. Nicola Schmidt gibt kompakte Hilfe und Anregungen für Gespräche mit Kindern in verschiedenen Lebensphasen und erklärt, wie Eltern ihren Kindern die richtigen Fragen stellen und besser zuhören.
Sie findet wissenschaftsbasierte Antworten auf die drängendsten Fragen. Mit alltagsnahen Beispielen und klaren Anleitungen. Wie finden wir den richtigen Ton, wenn wir unsere Kinder stärken, inspirieren und liebevoll durch Themen wie Liebe, Lügen, Geld oder Grenzen begleiten wollen?
Wir hatten euch in den sozialen Medien gefragt, welches Thema ihr euch aus diesem Buch hier im Blog wünschen würdet. Die meisten sagten Doktorspiele, Freunde finden und Tod. Da wir nicht das gesamte Buch hier abdrucken können, haben wir uns nun die Erlaubnis geholt, die Kapitel zu den Doktorspielen und zum Freunde finden hier publizieren zu dürfen. Für alle anderen: einfach das Buch schenken lassen oder selbst besorgen.
ÜBER DOKTORSPIELE SPRECHEN

»Doktorspiele« sind ein natürlicher Teil der Entwicklung von Kindern im Vor- und Grundschulalter. Schon Babys beginnen, ihren eigenen Körper zu entdecken – sie stecken ihre Hände und Füße in den Mund und mit einigen Monaten entdecken sie – besonders wenn sie windelfrei aufwachsen oder immer wieder Gelegenheiten ohne Windeln haben – auch ihre eigenen Geschlechtsorgane.
Zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr beginnen Mädchen und Jungen dann, andere in ihre Aktivitäten einzubeziehen. Sie erforschen sich selbst und ihre gleichaltrigen Freundinnen und Freunde. Ab dem vierten Lebensjahr nehmen »Doktorspiele« in der Regel die Form von Rollenspielen an: »Arzt-« oder »Vater-Mutter-Kind-Spiele«. Die Kinder erforschen ihre Geschlechtsorgane, imitieren das Verhalten von Erwachsenen (Händchen halten, küssen, heiraten) und spielen Zeugungs- und Geburtsszenen nach.
Grundsätzlich ist es wichtig, unseren Kindern die Grundlagen für diese Spiele beizubringen:
• Es spielen nur Kinder mit, die dies ausdrücklich wollen.
• Berührt und untersucht wird nur so viel, wie es für alle Beteiligten angenehm ist.
• Wir sind achtsam, damit wir einander nicht wehtun.
• Wir dürfen berühren, aber nichts in Körperöffnungen stecken.
• Niemand leckt am Körper des anderen.
• Die Spiele finden nur mit Gleichaltrigen statt.
• Der Ort und der Zeitpunkt müssen passen.
• Niemand übt Druck oder Gewalt aus, kein Kind wird durch Versprechungen oder Drohungen zu solchen Spielen gebracht.
• Es spielen nur Kinder mit, denen klar ist, was hier gespielt wird, die also verstehen, was mit ihnen passiert.
• Jedes Kind kann seine Zustimmung zu jeder Zeit zurückziehen. Wenn ein Kind einen Übergriff – auch von Gleichaltrigen – erlebt hat, dürfen wir als Erwachsene auf keinen Fall Fragen stellen wie:
• »Warum hast du dich nicht gewehrt?«
• »War es wirklich so schlimm?«
• »Vertraust du mir etwa nicht? Warum erzählst du nicht weiter?« Wir lassen das Kind stattdessen erzählen und stellen uns auf jeden Fall eindeutig hinter es. Wenn jemand anders Druck auf das Kind ausgeübt hat, können wir es zum Beispiel fragen:
Das artgerecht-Gespräch
• »War das ein sicherer oder ein unsicherer Mensch?«
• »War das eine sichere oder eine unsichere Berührung?«
• »Ist es ein sicheres oder unsicheres Geheimnis?«
Damit können wir auf die Konzepte zurückgreifen, die unser Kind schon kennt, und ihm Vertrauen vermitteln. Es muss die Dinge nicht bewerten, sondern nur sagen, wie es sich selbst damit gefühlt hat. Manche Kinder haben Schuldgefühle, weil sie zum Beispiel zuerst eingewilligt haben oder es sich zuerst gut angefühlt hat und dann plötzlich nicht mehr »gut« war. Dann sind die Kategorien »sicher« – »unsicher« leichter auszusprechen.
FREUNDE UND FREUNDINNEN FINDEN

Im Kindergarten ist das mit den Freundschaften oft noch sehr einfach: Ich mag dich. Ich mag dich nicht. Und morgen kann alles schon wieder ganz anders sein. In einer altersgemischten und gut begleiteten Gruppe wird jedes Kind jemanden finden, mit dem es spielen kann.
Richtig wichtig werden Freunde im Schulkindalter und hier wird es dann auch richtig kompliziert (warum, das erkläre ich in »artgerecht – das andere Schulkinderbuch«42). Spätestens jetzt stehen die ersten Gespräche zum Thema Freundschaft an.
WIE FINDEST MEIN KIND FREUNDE?
In der Forschung herrscht Konsens darüber, dass ein Schulkind – anders als ein Kleinkind übrigens – unbedingt Freunde braucht, um sich gut zu entwickeln. Jedoch kommen Freunde nicht von Allein daher. Manche Kinder tun sich leichter als andere – und manche tun sich richtig schwer.
Freundschaft fängt oft mit Sprache an: »Hey, ich bin Timmi, wie heißt du?« Wie Kinder auf andere zugehen, hängt deutlich davon ab, wie viele Möglichkeiten sie hatten und haben, ihre Eltern bei einer Kontaktanbahnung und in Gruppen zu beobachten. Gehen sie offen auf Menschen zu? Sehen sie an ihnen, wie sie mit einer Ablehnung umgehen? Haben sie überhaupt schon einmal erlebt, wie man in einer neuen Gruppe Kontakte knüpft?
Meine Kinder zum Beispiel sind, seit sie ganz klein waren, mit mir auf Messen, wo ich ständig mit neuen Menschen zu tun habe. Sie waren zehn Jahre lang jeden Sommer mit mir in Wildniscamps des artgerecht-Projekts. Sie konnten also regelmäßig beobachten, wie ich mich mit fremden Menschen bekannt mache, wie ich Gespräche anfange und führe. Sie konnten von mir lernen, welchen Menschen man vertraut oder von wem man lieber Abstand hält, wie man höflich und verbindlich ist.
Sie haben in den Camps gesehen, wie Erwachsene miteinander reden, sich kennenlernen, gemeinsam lachen, singen, kochen und Feuer machen. Sie haben jeden Sommer neue Kinder kennengelernt, haben entschieden, mit wem sie spielen wollten, und konnten immer und immer wieder in der sicheren Gruppe des Geschwisterteams üben, wie man Kontakte zu fremden Menschen knüpft. Sie hatten viele Gelegenheiten, zu lernen, wie man Menschen anspricht, und können es heute dementsprechend gut. Trotzdem gehen sie völlig unterschiedlich an die Sache heran. Wer die artgerecht-Bücher kennt, weiß, wieso das so ist: Jedes Kind ist anders.
Unsere Kinder lernen das Kontakteknüpfen vor allem von uns. Das heißt auch: Wenn sie es noch nicht gelernt haben, ist das keine charakterliche Eigenschaft, sondern einfach nur etwas, worüber wir jetzt sprechen können. Wir können diese Gespräche ganz entspannt bei uns selbst beginnen.
Würden wir direkt zu unserem Kind sagen »Hey, du solltest mehr Freunde haben, ich möchte mit dir mal darüber sprechen, was da los ist«, fühlt es sich unter Umständen schlecht. Wenn wir dagegen erst mal erzählen oder gemeinsam herausfinden, wie es eigentlich in unserer Familie so mit Freunden steht, wird es ein gemeinsames Projekt.
Das artgerecht-Gespräch
• »Welche Freunde haben wir als Familie?«
• »Welche Art Freunde sind das – wer sind enge Freunde, wer sind eher Bekannte?«
• »Was verbindet uns mit den Freunden – jahrelange Freundschaft, eine Sportart, gemeinsame Interessen, gemeinsame Nöte?«
• »Was erwarten wir von Freunden, was müssen sie leisten (wir müssen ihnen vertrauen können), was nicht (sie müssen zum Beispiel nicht immer perfekt sein)?«
• »Was für ein/e Freund/in möchten wir selbst sein?«
Mit solchen Gesprächen machen wir uns ein Bild davon, wie unser Freundesnetzwerk bisher aussieht – was übrigens auch für uns Erwachsene sehr aufschlussreich sein kann. Viele Eltern, die mir erzählen, dass ihre Kinder schwer Freunde finden, stellen im Laufe unseres Gesprächs fest, dass sie selbst auch nur wenige Freunde haben und sich schwer damit tun, Menschen anzusprechen oder ihnen zu vertrauen.
Das Schöne ist: Wenn wir jetzt denken, dass wir mehr Freunde haben sollten, können wir es gemeinsam lernen. Grundlage dafür ist das Wissen, wie man sich vorstellt und wie man einen anderen Menschen kennenlernt. Dazu gehören ganz einfache Sätze, die ein Gespräch beginnen:
• »Hi, ich bin … Wer bist du?«
• »Was machst du hier?«
• »Was spielst du gern?«
• »Hast du Lust …«
Egal ob im Zoo, im Kindergarten, auf einem Geburtstag oder auf dem Spielplatz: Mit diesen einfachen Anfängen lässt sich leicht eine neue Verbindung schaffen.
Wie stellt man sich vor?
Wie fragt man, um etwas vom anderen zu erfahren? Wie lädt man jemanden zum Spielen ein? Kindern hilft es, das zuerst in vertrauter Umgebung zu üben, zum Beispiel auf einem Familienfest, um es dann später auch in einer Kindergruppe zu können. Je älter Kinder sind, desto alberner finden sie es, das zu üben. Dann wechseln wir die Seiten und sind selbst diejenigen, die nicht wissen, wie es geht – und die Kinder erklären es uns. Üben mit uns. Auch so lernen sie es.
Freundschaft zwischen Menschen beruht auf Gemeinsamkeiten – gemeinsamen Interessen, Erfahrungen oder Tätigkeiten. Darüber können wir mit unseren Kindern sprechen. Vielleicht sind in ihrer Klasse noch andere Kinder, die sich auch für Katzen, Lego, Eislaufen oder Musik interessieren, ohne dass man es ihnen ansieht. Wie ließe sich das herausfinden?
Das artgerecht-Gespräch
• »Was machst du gerne nach der Schule?«
• »Hast du ein Haustier? Wenn du eins haben könntest, würdest du gerne eins haben? Welches?«
• »Was spielst du gerne?«
• »Welche Musik hörst du gerne?«
• »Machst du Sport? Wenn ja, was?«
• »Welche Videospiele spielst du gerne, was schaust du gerne für Sendungen?«
Besonders Schulkinder tendieren dazu, von sich selbst zu sprechen – ihre Welt dreht sich noch sehr stark um die eigene Person. Sie können in Gesprächen mit uns lernen, Fragen zu stellen und die Welt eines anderen Menschen zu erkunden.
Wir können auch ihnen diese Fragen stellen, damit sie merken, wie angenehm es ist, wenn jemand offene Fragen stellt. So lassen sich auch Gespräche vermeiden, die das Kind frustriert zurücklassen, weil sie aus geschlossenen Fragen bestehen. Das wären Gespräche wie: »Magst du Pferde?« »Nö!« »Hunde?« »Nö!« – und schon fühlt es sich komisch an. Mit offenen Fragen ist es viel einfacher.


























