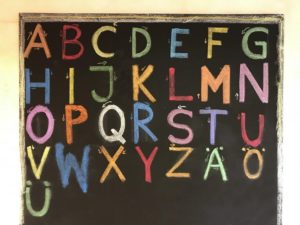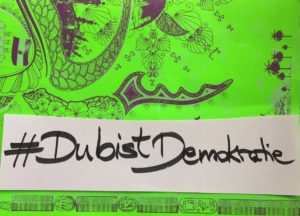Ihr Lieben, heute geht es mal um Politik im Kinderzimmer, beziehungsweise, wie wir es schaffen, auch in der Begleitung unserer Kinder Haltung zu zeigen für demokratische Werte. Und obwohl sich das jetzt vielleicht erstmal nach einem „Was soll ich denn NOCH alles machen und beachten?!“ anhört, ist das gar nichts, was ihr extra leisten müsst.
Es geht einfach um eure Grundhaltung. Erziehungsexpertin Inke Hummel hat zusammen mit vielen weiteren Bindungsprofis ein Buch für Kita, Ganztag und Schule dazu geschrieben, denn es fängt wirklich schon bei der Wortwahl und ganz im Kleinen an: Haltung zeigen für demokratische Werte
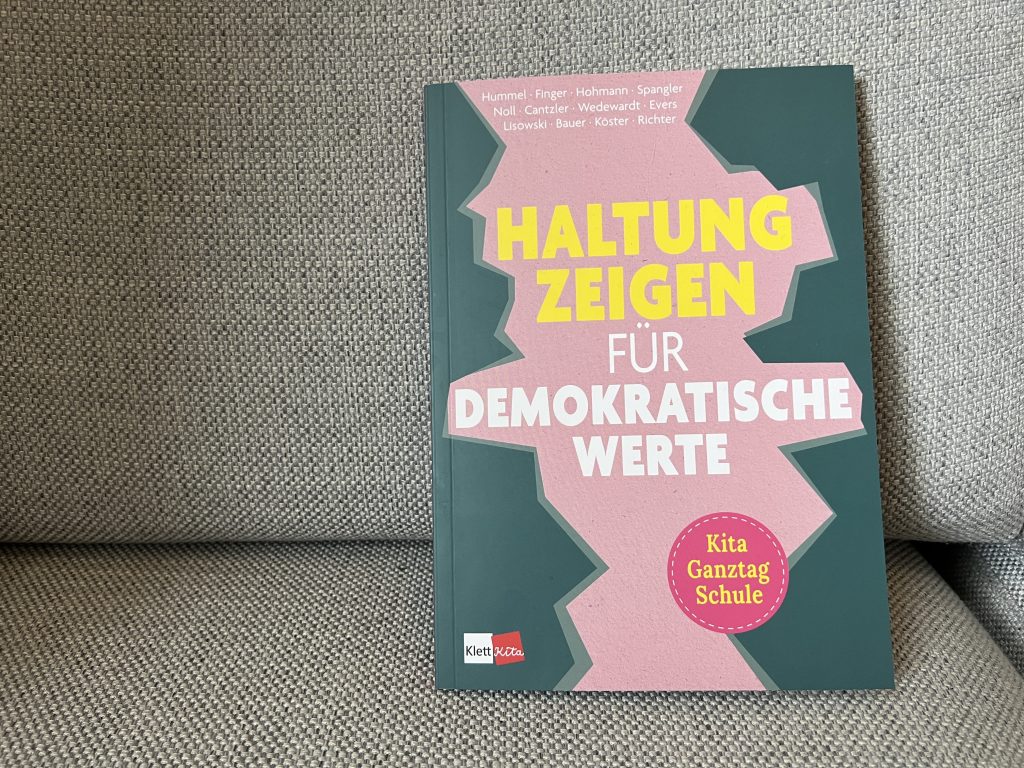
Liebe Inke, was müssen wir denn noch alles machen, mögen sich einige Eltern fragen, warum braucht es jetzt auch noch Politik im Kinderzimmer?
Gute Frage gleich zum Start, denn es geht wirklich nicht um eine weitere Aufgabe. Es geht darum zu erkennen, wie wertvoll ein beziehungsstarkes Familienleben nicht nur für die psychische Gesundheit eines Kindes ist, sondern auch für die Stabilität und Sicherheit unserer Gesellschaft.
Alle Pädagoginnen und Pädagogen, die bei dem Buch mitgewirkt haben, möchten gern aufzeigen, wie der Umgang mit Kindern und unsere politische Realität miteinander verwoben sind. Herbert Renz-Polster hat das vor Jahren schon in seinem Buch „Erziehung prägt Gesinnung“ deutlich gemacht, wir haben es jetzt mit alltagspraktischen Impulsen verbunden.
Einerseits hoffen wir, dass wir vor allem Fachkräfte dafür gewinnen können, Kindern gegenüber eine zugewandte, gleichwürdige Haltung einzunehmen, so dass sie nicht belastet, bedrängt, übersehen oder unnötig gestresst werden. Denn ein andersartiger Umgang mit Kindern widerspräche ohnehin jedem Gedanken an Kinderschutz und Kinderrechte. Anderseits möchte wir allen Fachkräften und auch Eltern, die bereits diese Haltung leben, den Rücken stärken, denn sie tun dadurch etwas Großes, nicht nur für ihr Kind.
Das heißt, wir brauchen einfach nur Haltung, nicht noch nen Zusatzpunkt auf unserer Kinderbegleitungs-Agenda?
Genau. Man muss nicht noch etwas tun, sondern Kindern auf eine bestimmte Art und Weise begegnen: in Gleichwürdigkeit, mit Partizipationschancen. Das meint, Kinder sollten nicht schlechter oder gewaltvoller behandelt werden als ein Erwachsener, nur weil sie kleiner sind. Und sie sollten nicht weniger gehört werden in ihren Bedürfnissen, Wünschen und Ideen (Achtung: „gehört werden“ heißt nicht „erfüllt bekommen – um hier gleich einem typischen Einwand zuvorzukommen). Es geht um das Wie, nicht um ein „on top“.
Inwiefern hältst du Pädagogik für politisch?
Pädagogik beschäftigt sich damit, wie jeder Mensch einerseits seine Persönlichkeit gesund entfalten kann, andererseits in unser soziales Gefüge passen kann. Das ist ein herausfordernder Balanceakt. Wie gut er gelingt, bestimmt mit, wie gesund und glücklich ein Kind aufwachsen kann. Es bestimmt aber am Ende auch mit, wie funktional, sozial und sicher unsere Gesellschaft wird.
Wird beispielsweise die wilde Persönlichkeit eines Kindes kontinuierlich durch Strafen unterdrückt, wird das Kind leiden und es kann auch zu einer Gefahr für sein Umfeld werden, denn solch ein Leidensdruck kann zu Enthemmung führen, also zum Beispiel zu fehlendem Mitgefühl und zu Aggressionen. Im gesellschaftlichen Miteinander kann sich das im Alltag zeigen, möglicherweise am Schulvormittag, aber auch irgendwann auf dem Wahlzettel.
Geht es dabei auch schon um Aussagen wie „Hier wird gegessen, was auf den Tisch kommt“ versus „Hey, wenn du mal probieren magst, gern, sonst isst du drumherum“?
Definitiv. Da sind wir ja mittendrin im Thema Gleichwürdigkeit. Wenn eine erwachsene Person etwas nicht essen mag, würden wir auch nicht anzweifeln, dass sie einfach nur zu stur ist. Einem Kind dürfen wir genauso interessiert und fragend begegnen: Warum mag es etwas nicht probieren? Riecht es komisch? War die Konsistenz beim letzten Mal seltsam? Was könnte denn sonst mal auf dem Teller sein?
Kindern und Erwachsenen sollte mit dem gleichen Respekt begegnet werden. An dieser Stelle kommt dann gern ein Vorwurf wie: „Ja, aber wenn das Kind auf die vierspurige Straße rennt, kann ich auch nicht höflich fragen!“ Das wäre aber ein Vergleich wie von Äpfeln und Birnen, denn natürlich muss ich den Reifegrad eines Kindes beachten. Manche Gefahren kann es nicht erkennen. Da muss ich es schützen, auch beim Essen, und zum Beispiel nicht zu viel Süßkram im Haus haben und dafür Regeln aufstellen. Aber ich kann das immer zugewandt tun und oft auch beteiligend: Wie könnte eine Regel aussehen?

Ist Demokratie im Erziehungsprozess möglich? Manchmal nennt mein Mann uns Familien-WG, weil alle mitentscheiden…
Das finde ich cool. Ich spreche ja auch gern von WG, aber eher, weil man spätestens im Teeniealter manchmal merkt, dass da jemand mit bei einem wohnt, den man sich bei einem echten WG-Casting nicht unbedingt ausgesucht hätte. 😀
Aber zurück zum Thema: Ich empfehle, spätestens ab dem Vorschulalter Familienkonferenzen abzuhalten. Wenn es ein Thema gibt, über dass man immer wieder streitet, lohnt es sich, sich in Ruhe hinzusetzen und auszutauschen, wer was braucht, wer welche Idee dazu hat und wie ein Kompromiss aussehen könnte. Dafür muss jeder ein bisschen aus seiner Komfortzone kommen, Kinder wie Eltern. Und natürlich haben wir hier, wie eben schon gesagt, Verantwortung für den Reifegrad der Kinder, aber auch dafür, nicht autoritär und diktatorisch zu werden. (Wer Inspiration dazu mag: https://geborgen-wachsen.de/produkt/familienkonferenz-planer/)
Wie können wir Diskriminierung schon von klein auf im Keim ersticken?
Zum Beispiel indem wir auf unsere Sprache achten (kein „dafür bist du noch zu klein“ oder gar „du Hosenscheißer“), aber auch auf unsere Handlungen (Warum sollen Kinder alles an Essen probieren, während wir das von Erwachsenen nicht fordern würden? Warum sollen sie ein anderes Kind an die Hand nehmen, wenn wir Großen auch nicht jedem die Hand geben möchten? Warum wird nicht darauf geachtet, dass eine Klotür in der Kita nicht von anderen geöffnet wird, wenn ein Kind dort sitzt – das würden Erwachsene auch nicht wollen?! usw.).
Oder indem wir Kinder ehrlich beteiligen und darauf achten, dass sie an vielen Stellen ihrem Reifegrad entsprechend mit- oder sogar selbstbestimmen können. Und hier ist es wichtig, nicht gleich das Thema von sich zu schieben, weil es herausfordernd klingt und weil einem gleich ein „Megabeispiel“ einfällt, wo das ja echt nicht möglich ist, weil sonst totales Chaos ausbricht. Dazu noch ein Beispiel: Kann ich das Kind morgens daran beteiligen, was es anzieht? Nein, auf gar keinen Fall, weil ich sonst vielleicht vor 11 Uhr nicht aus dem haus komme?!
Das ist ein Scheinargument. Ich kann es immer beteiligen, eine Auswahl bieten, Fragen stellen, aber eben auch Grenzen setzen, die seinem Reifegrad entsprechen. So kann es noch nicht verstehen, warum es wichtig ist, bis zu einer bestimmten Uhrzeit in der Kita zu sein, weil ich als Elternteil pünktlich zur Arbeit muss. Aber ich kann die Grenze setzen „bis 8:15 Uhr musst du deine Entscheidung getroffen haben, sonst muss ich sie treffen und kann dir dann anbieten, dass du im Schlafanzug gehst oder wir einen Pulli drüberziehen“ oder ähnliches.
Und ja, dazu darf auch mal gehören, dass das Kind meckernd in die Kita getragen werden muss, weil es eben noch unreif ist, aber auch das kann ich dann sichernd und zugewandt begleiten und muss nicht ausfallend werden: „Du schaffst das heute nicht. Ist okay. Ich helfe dir und trage dich jetzt und morgen versuchen wir es anders.“ Das kann die Haltung dahinter sein.
(Und ich höre noch ein Scheinargument: „Aber niemand kann das immer so klar und nett sagen.“ Stimmt. Jeder flippt mal aus. Unsere Stressressourcen sind endlich. Das darf passieren. Das passiert wahrscheinlich auch unserer Partnerin oder unserem Partner gegenüber mal. Trotzdem ist das kein Argument dafür, Respektlosigkeit als Grundhaltung haben zu dürfen.)

Bildung ist die mächtigste Waffe, die du verwenden kannst, um die Welt zu verändern, sagte schon Nelson Mandela…
Definitiv. Und da denke ich direkt an einen der wichtigsten Grundsätze im menschlichen Miteinander: das Fragen. Das echte Interesse aneinander. Wenn wir Bildung auch mit Wissen gleichsetzen, dann gehört da nämlich auch das Wissen übereinander dazu. Und wenn ich viel über mein Gegenüber, in dem Fall also mein Kind, weiß, weil ich ihm zuhöre, weil ich ihm Fragen stelle, weil ich es einbeziehe, laufe ich weniger Gefahr, es falsch zu verurteilen, es misszuverstehen, in Distanz zu meinem Kind zu gehen.
Und jetzt kann man diese Gedanken auch noch mal eher aus gesellschaftlicher Perspektive sehen: Je besser wir einander kennen, desto weniger geraten wir in Distanz und Vorurteile übereinander. Das kann man zu Hause üben, um letzten Endes auch unser Land auch politisch zu gestalten.
Meinst du, es lassen sich mit einer guten Bindung extreme politische Auswüchse – in welche Richtung auch immer – verhindern bzw. verringern?
Pädagogik hat leider keine Garantien im Gepäck, weil Entwicklung immer viele Ursachen und Faktoren hat. Aber sie bringt Wahrscheinlichkeiten mit. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, extreme politische Ansichten zu entwickeln, wenn ich als Kind in Urvertrauen, Partizipation, Gleichwürdigkeit und diskriminierungsbewusst groß werden durfte, ist sicher sehr gering.
Was wünschst du dir politisch in den Kinderzimmern dieser Welt?
Kinderschutz, Gewaltbewusstsein, Zeit, Zuhören, Liebe. Und dass Eltern versuchen, die Persönlichkeit ihres Kindes wertzuschätzen und zu fördern, sowie die Beziehung zu ihm über Leistungsansprüche stellen.