Ihr Lieben, neulich haben wir in unseren Insta-Storys gefragt, ob es etwas gibt, für das ihr euch schämt. Anlass war mein Artikel darüber, dass ich meine Beine nicht mag, deshalb jahrelang immer in langen Hosen gejoggt bin, nun aber auf die Scham pfeife und endlich Shorts anziehe.
Wir haben unzählige Nachrichten bekommen von Frauen, die sich für ihre Körper schämen, das hat uns sehr berührt und sehr nachdenklich gemacht. Sabine hat sich auch bei uns gemeldet, schrieb, dass sie sich für ihre geringe Bildung schämt. Uns hat sie anschließend mehr darüber erzählt, wir danken ihr sehr für ihr Vertrauen.
Liebe Sabine, auf unsere Umfrage hast du dich damit gemeldet, dass du dich für deine geringe Bildung schämst. Lass uns mal vorne beginnen. Was haben deine Eltern gearbeitet und wie wichtig war Bildung in deinem Elternhaus?
Meine Eltern hatten mittlere Bildungsabschlüsse und Ausbildungsberufe in Angestelltenverhältnissen. Heute sind sie Rentner. Beide waren fleißig und hatten häufig sogar zwei Jobs, damit wir finanziell über die Runden kommen. Das Geld haben sie aber auch gerne in Dinge gesteckt, die andere sehen konnten, also z.B. Kleidung. Rücklagen oder Versicherungen dagegen fanden sie nicht so wichtig. Es galt: Mehr Schein als Sein.
Ich habe in meinem Elternhaus wenig bis gar keine positive Bestärkung bekommen. Mein Vater hat mir oft gesagt, ich sei dumm. Was definitiv dazu geführt hat, dass ich wenig Selbstbewusstsein habe und mich schwer getan habe, Freunde zu finden.
Wie warst du in der Schule?
Ich war eine fleißige Schülerin, ich musste immer lernen, zugeflogen ist mir nichts. Ich habe pflichtbewusst meine Aufgaben erledigt und war eigentlich ganz gerne in der Schule.
Was für Berufswünsche hattes du als Kind und Jugendliche?
Ich wollte gerne Hebamme werden. Meine Eltern rieten mir wegen des Schichtdienstes und anderer Gründe dringend ab. Mir war es wichtig, meinen Eltern zu gefallen und habe deshalb diesen Traum schnell begraben. Ich habe dafür nicht gekämpft, weil ich eben einfach nicht selbstbewusst war.
Mit welchem Schulabschluss hast du die Schule verlassen und wie ging es dann weiter?
Ich habe auf der Gesamtschule noch kurzzeitig die 11. Klasse der Oberstufe besucht. In Mathematik und Französisch bekam ich Schwierigkeiten, hätte Nachhilfe oder mehr Förderung gebraucht. Meine Eltern sagten dann, es sei ihnen aus finanziellen Gründen lieber, wenn ich von der Schule abgehe und eine Ausbildung mache.
Also bin ich mit 17 von der Schule abgegangen und habe bei uns im Ort im kaufmännischen Bereich als Praktikantin gestartet und habe bei nächster Gelegenheit die Ausbildung zur Bürokauffrau gestartet. Das war das, was meine Eltern wollten.
In welchen konkreten Situationen konkret schämst du dich heute und was macht diese Scham mit dir?
Ich lebe heute in einem Umfeld und Freundeskreis, wo ich die Einzige ohne abgeschlossenes Studium oder toller Karriere bin. Um mich herum: Ärzte, Lehrer, Juristen, Journalisten. Definitiv haben alle mehr Verantwortung und erleben und verdienen viel mehr in ihren Berufen als ich.
Tja, was macht das mit mir….Ich bin mir sicher, dümmer zu sein als unsere Freunde. Deswegen halte mich bei manchen Themen zurück, weil ich meiner Allgemeinbildung nicht traue. Ich schäme mich immer, wenn ich z.B. von neuen Bekanntschaften gefragt werde, was ich beruflich mache. Ich selbst würde ich so eine Frage deshalb nie stellen, obwohl mein Gegenüber mich meist aufrichtig interessiert. Genauso schäme ich mich, wenn im Gespräch rauskommt, dass ich bereits mit 24 Mutter wurde, irgendwie verbindet man ja mit so früher Mutterschaft auch eine fehlende Bildung oder Karriere.
Die Scham fühlt sich vielleicht ähnlich an, wie andere Menschen sich für ihren Körper schämen, wenn Sie sich beim Arzt ausziehen müssen und deshalb Arzttermine vermeiden. Ich vermeide eben Themen wie Schulabschluss, Karriere, Beruf.
Hast du dir überlegt, ob du dich weiterbilden willst und wenn ja, warum hast du es noch nicht gemacht?
Heute hätte ich von meinem Mann die Unterstützung dazu. Er würde sich sogar freuen, glaube ich. Ich bin aber nicht stark belastbar und befürchte, deshalb zu scheitern oder nicht schlau genug zu sein oder unsere Familie damit zu belasten. Ich lege mir gedanklich Szenarien zurecht, warum eine Umschulung nicht gut wäre oder ich scheitern könnte…
Wenn du heute nochmal ganz von vorne anfangen könntest – welchen Bildungsweg würdest du nehmen?
Ich würde mich von meinen Lehrern beraten lassen, welcher Schulabschluss für mich realistisch wäre. Würde dann hart daran arbeiten und mich früher von den Wünschen und Ideen meiner Eltern lösen. Ich würde Hebamme werden, vielleicht selbstständig arbeiten und Frauen beistehen. Darin wäre ich bestimmt gut.
Wie wichtig ist dir das Thema Berufsbildung bei deinen Kindern?
Uns ist wichtig, dass sie etwas machen, was ihnen Freude bereitet. Aus Freude entsteht Enthusiasmus und Engagement. Wir bemühen uns immer, die Beiden gut zu fördern und zu unterstützen und so möglichst gute Voraussetzungen zu schaffen.
Unsere Freunde vermitteln ihren Kindern, dass ein Abi das A und O ist. Das glaube ich gar nicht. Wenn man liebt, was man tut, an sich selbst glaubt, mutig und fleißig ist, sich immer weiterentwickelt, kann man viel erreichen und verdienen.
Zum Glück sind unsere Kinder selbstbewusst und stehen sich nicht selbst im Weg, so wie ich. Sie werden ihr Berufsleben meistern und nicht so schnell aufgeben. Und wenn sie mal nicht weiter wissen, finden wir gemeinsam einen neuen Weg.















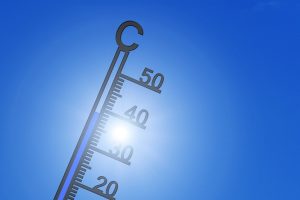











15 comments
Die Überschrift ist irreführend. Die Sabine ist erst nach der 11. Klasse von der Gesamtschule abgegangen, also hat man damit normalerweise die Mittlere Reife oder mindestens einen Hauptschulabschluss. Danach folgte eine kaufmännische Ausbildung als Bürokauffrau, also ein berufbildender Abschluss. Von „ungebildet und ohne Abschluss“ kann also bei weitem keine Rede sein. Es ist kein Abitur und keine akademische Bildung – na und? Es müssen nicht alle Menschen auf der Welt studiert haben, um als gebildet und erfolgreich zu gelten. Wenn man sich überwiegend in Akademiker-Kreisen bewegt und sich dadurch ständig mit seinem Ausbildungsberuf „minderbemittelt“ fühlt, ist es irgendwo auch die Frage des eigenen Mindsets. Man muss kein Akademiker sein, auch als Bürokauffrau kann man ein offener, intelligenter und redegewandter Mensch sein, mit dem man interessante Gespräche führt. Nichts wofür man sich schämen muss.
Ein Abi und Studium ist nicht alles im Leben und Juristen, Lehrer oder Ingenieure sind nicht automatisch die besseren Menschen.
Es ist auch nie zu spät für etwas neues, wenn man unbedingt will. Wer weiß, ob man als Hebamme sooo viel glücklicher gewesen wäre. Was ich da von einer aus meiner Familie sehe, was sie leistet ist ein enormer Aufwand: gibt keine geregelten Arbeitszeiten, dafür eine hohe psychische Belastung, dazu wird Flexibilität erwartet und regelmäßig verpflichtende Fortbildungen. Da ist nun auch mit Mitte 40 definitiv der Wunsch nach mehr Stabilität und einer beruflichen Veränderung groß. So manchen Leuten hängt der „Traumberuf“ nach dem Studium zum Hals raus, wenn man ihn erreicht hat und weiß, was alles dazu gehört.
Hallo Sabine, ich habe mein erstes Kind auch mit 24 bekommen. Mit Abi und Studium. Das ist doch kein Zeichen für Nichtbildung.
Hallo Sabine,
ich kenne das Gefühl leider auch – und ich habe Abitur und studiert (im sozialen Bereich). Ich habe einfach so ein schlechtes Gedächtnis, in der Schule hat es gerade so gereicht (inklusive Nachhilfe in mehreren Fächern) und auch jetzt im Alltag bin ich ständig damit konfrontiert, dass ich mir die einfachsten Dinge nicht merken kann (wohin fahren die Freunde noch mal in den Urlaub, wie hieß noch mal der Papa von der Kindergartenfreundin..). Auch die einfachsten Kinderfragen (warum regnet es, wie funktioniert die Kanalisation) kann ich spontan nicht beantworten und muss entweder kurz googlen oder antworte mit „das müssen wir den Papa fragen“. Auch meine Allgemeinbildung ist wirklich schlecht und ich fühle mich oft dümmer als mein Freundeskreis. Ich versuche mir auch vor Augen zu halten, dass ich deshalb nicht weniger Wert bin, aber bin deshalb trotzdem oft geknickt und mit mir selbst unzufrieden.
Liebe Sabine,
Du solltest Dich nicht vor Deinen Feeunden schämen. Nicht weil Du dumm bist, nicht weil Realschulabschluss ja nichts schlechtes ist (heutzutage gehen 9% der.Jugendlichen ohne Abschluss), sonder weil Deine Freunde Deine Freunde sind, sie kennen Dich und mögen Dich wie Du bist. Das zählt. Schulabschluss hat auch überhaupt nicht zwingend was mit Allgemeinbildung und schon gar nichts mit dem Wert eines Menschen zu tun.
Für die Zukunft wünsche ich Dir, dass Du gut bist/bleibst (Werte) und Dir vertraust und einfach probierst wozu Du Lust hast und was Dir guttut.
Marco
(Lehrer)
Hallo Sabine,
ich kenne beruflich viele Ärzte und einige sind richtige Knallköpfe die bis auf Medizin vom Nichts anderem eine Ahnung haben. Ein Uniabschluss ist kein Garant für eine gute Allgemeinbildung.
Zum anderen würde ich dir raten aus der Selbstmitleidspirale herauszukommen.
Es ist nie zu spät dich beruflich noch mal neu zu orientieren. Selbst wenn du scheitern solltest hättest du es zumindest versucht.
Man bereut doch eher die Dinge die man nicht getan hat.
Lg
Es ist nicht so wichtig, welchen Beruf man macht. Hauptsache man macht seine Arbeit gut. Ich freue mich immer, wenn jemand mir gut weiterhelfen kann.
Allgemeinbildung kommt nicht vom Beruf, sondern mit dem Leben.
Liebe Sabine,
aber selbstverständlich hast du einen Schulabschluss!
Mit der abgeschlossenen Ausbildung hast du automatisch den Hauptschulabschluss, der Gesellenbrief, also das Abschlusszeugnis, entspricht stets dem nächsthöheren Abschluss.
Davon abgesehen hast du die 10. Klasse der Gemeinschaftsschule bestanden und damit nach aktuellen Regeln den Realschulabschluss bestanden.
Auch ohne Prüfung.
Du schreibst nicht, wie alt du bist, und je nach Bundesland läuft das etwas anders. Wenn es die alte Schule noch gibt, kann man sich dort mit dem Zeugnis erkundigen, ob man dir einen Realschulabschluss bescheinigen kann.
Aber: das alles ist keine Hilfe dabei, dass du deine eigentlichen Berufsziele nie angesteuert hast.
Da liegt wohl eher die Krux.
Möchtest du immer noch Hebamme werden? Das ist mittlerweile ein Studium.
Aber vielleicht gibt es Berufe drum herum, die dir auch Freude machen würden, beispielsweise als Kinderkrankenschwester oder Familienpflegerin?
Auch mit einer kaufmännischen Ausbildung gibt es Möglichkeiten zum Quereinstieg in soziale Themen.
Du schleppst da etwas aus einer anderen Zeit mit dir herum, das du selbst aber ablegen kannst, wenn du möchtest.Trau dich!
E
Wie schade, liebe Sabine! Mir kommt es eher so vor, als ob du es bereust, keine Hebamme geworden zu sein. Dafür wäre das Abitur damals gar nicht nötig gewesen. Du sagst ja selber, dass deine Kinder nicht zwingend das Abi machen müssen. Ich persönlich habe zwar Abi gemacht, aber danach eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Ich wüsste nicht, wofür ich mich schämen sollte, nur, weil ich nicht studiert habe, bin ich doch nicht dumm und du bist es auch nicht. Wir benötigen nicht nur hochgebildete Akademiker sondern Menschen, die ganz normale Jobs machen, damit unser Leben auch weiterhin lebenswert in dieser Gesellschaft bleibt. Also, Kopf hoch, deine Fähigkeiten werden genauso benötigt, wie die eines Arztes oder einer Juristin! Du bist genug! Steh zu dir! Und vielleicht erfüllst du dir ja doch noch den Traum Hebamme zu werden.
Liebe Sabine,
Deine Geschichte macht mich traurig. Ich finde die heutige Einstellung jeder muss studieren und Abi haben ganz schrecklich. Wieso sollte man dumm sein, nur weil man kein Abitur hat? Wie viele Berufe wären nicht besetzt? Da du allerdings nicht glücklich bist, ist es natürlich so nicht schön. ich weiß leider nicht wie alt du bist und wie die Bedingungen für eine Ausbildung als Hebamme sind, aber eigentlich ist es nie zu spät das zu machen was man sich wünscht. Informiere dich, ob es nicht jetzt noch möglich wäre die Ausbildung nachzuholen. nur weil man einen Realschulabschluss hat ist man ja nicht dumm, glaub an dich und mach das was dich glücklich macht.
viele Grüße
„Kein Schulabschluss“ wie in der Überschrift steht stimmt doch nicht. Hier geht es doch eher um „nur“ eine (ungeliebte) Ausbildung und „alle anderen“ haben studiert. Gleichzeitig sagst du, das Abi sei nicht alles. Das passt für mich nicht zusammen.
Dass sie keinen Schulabschluss hat steht in ihren Aussagen im Text auch so nicht drin. Ich hoffe doch sehr, dass sie es nicht so extrem sieht.
Sie ist in der 11. Klasse abgegangen und hat somit wahrscheinlich mittlere Reife, mit einer Ausbildung und mehreren Jahren Berufserfahrung könnte sie durch berufliche Qualifikation auch noch studieren, wenn sie möchte.
Für ihren Bildungsweg braucht sie sich nicht zu schämen, sie hat wahrscheinlich auch nicht weniger Allgemeinbildung als viele Akademikerinnen.
Ich finde auch, dass dem Abi viel zu viel Bedeutung zugesprochen wird.
Die Überschrift ist meiner Meinung nach fehlerhaft, aber bei „kein Abitur“ wäre weniger reißerisch gewesen und hätte wahrscheinlich auch weniger Klicks bedeutet.
@Kia: geht mir ähnlich. Mal abgesehen davon, dass die Überschrift sachlich falsch ist, steckt mir da sehr viel Passivität drin und eine gewisse Opferhaltung, an der man vielleicht arbeiten könnte. An irgendeinem Punkt im Leben muss man anfangen eigene Entscheidungen zu treffen. Das ist anstrengend und die Umsetzung erst recht, aber man wächst daran und muss nicht Jahre später betrauern, dass die Eltern die Nachhilfe nicht bezahlt haben (z.B.). Die Verantwortung für sich selbst zu tragen ist nicht einfach, aber wer das eine will, muss das andere mögen. Und die eigene Zufriedenheit sollte gewiss nicht an den akademischen Abschluß gekoppelt sein. Spätestens mit etwas Lebenserfahrung merkt man doch, dass Lebenstüchtigkeit, Tatkraft, Sozialkompetenz, Zufriedenheit und Bildung auch ohne Schul/Unikarriere möglich sind.
Liebe Sabine! Du hast dich für überhaupt gar nichts zu schämen. Du hast eine Ausbildung, einen Job, scheinbar tolle Kinder, einen Mann! Das ist doch so viel mehr, was dich ausmacht. Du hast die Schule abgebrochen, das ist natürlich nicht schön. Aber nach einem gezielten Schulabschluss fragt doch eigentlich niemand. Du hast eine Lehre gemacht. Das zählt doch. Und es heißt nicht, dass du deswegen eine geringe Bildung hast. Das du selber nicht zufrieden bist, ist die eine Sache, aber bitte denke nicht, dass andere dich so sehen.
Ich habe auch viele Lehrer im Bekannten- und Freundeskreis. Das fand ich zwischzeitlich auch merkwürdig, wenn es zum Beispiel um die Studienzeit ging oder deren Verbeamtung.
Ich bin damals vom Gymnasium abgegangen zur Realschule und habe danach eine Ausbildung gemacht. Mein Mann war auf der Hauptschule und ist Kfz Mechaniker. Uns geht es gut mit unseren Jobs und wir haben ein tolles Leben mit unseren Kindern. Wir vermitteln ihnen auch, dass es wichtig ist, auf eigenen Beinen zu stehen und zufrieden zu sein. Dafür ist kein Abitur notwendig. Unser Großer ist kein super Schüler, aber ein guter Handwerker zum Beispiel. Er soll selbstbewusst seinen Weg gehen.
Bei der Überschrift habe ich tatsächlich gedacht, jetzt kommt ein Artikel über eine Frau, die sich durch verschiedene Hilfsjob hangelt. Das meine ich jetzt nicht negativ. Bitte nicht falsch verstehen. Und während des Lesens dachte ich dann: Ist doch alles super. Ausbildung gestartet und alles ist gut gegangen!
Ich wünsche dir für deine Zukunft alles Liebe und Gute! Und wenn der Wunsch nach einer Umschulung immer noch so groß ist, dann nimm es in Angriff. Du kannst das schaffen!
Liebe Sabine, ich bin mir ganz sicher, dass du immer noch Hebamme werden könntest wenn du das möchtest. Du hast mit Sicherheit noch einige Berufsjahre vor dir und hast es verdient, die auch mit Freude am Job zu verbringen. Glaub an dich!
Liebe Sabine, vielen Dank für deinen Bericht. Ich habe größten Respekt davor, dass du es geschafft hast, deinen Kindern gegenüber eine andere Einstellung zu leben als deine Eltern es getan haben. Ich denke, dass du eine wunderbare Hebamme wärst, denn das wichtigste dafür ist meiner Erfahrung nach Leidenschaft und Empathie und es liest sich so, als bringst du beides mit. Vielleicht kannst du ja erst einmal Doula werden? Da wärst du bestimmt eine Bereicherung für werdende Eltern. Und wenn du die Zeit und Kraft dafür hast, kann dir vielleicht professionelle Unterstützung helfen, deine alten Glaubenssätze aus der Kindheit Stück für Stück hinter dir zu lassen. Alles Gute für dich, glaub an dich!