Ihr Lieben, ich weiß gar nicht, wann ich Barbara Vorsamer zum ersten Mal gesehen habe, vielleicht war es die Blogfamilia, jedenfalls verfolge ich schon länger, was sie so tut und schreibt und liebe besonders, wenn der Familien-Newsletter der Süddeutschen Zeitung, den sie vor sechs Jahren erfunden hat, aus ihrer Feder stammt.
Nun hat die Journalistin und Zweifachmutter aus München (wir haben sie übrigens hier schon einmal vorgestellt, weil ihr Mann die Arbeitsstundenzahl reduzierte, um sich mehr um die Familie kümmern zu können) ein Buch geschrieben, das mich sehr berührt hat, ein Buch über ihre Erkrankung: die Depression. Mein schmerzhaft schönes Trotzdem handelt von ihrem Leben mit der Depression.
Ich habe in diesem Jahr noch kein anderes Buch in einem Rutsch durchgelesen, weil das die Weltlage irgendwie nicht hergab, aber dieses Werk hat mich aus der Quarantäne raus in eine Gefühlswelt katapultiert, die mich mitgenommen und immer wieder hat mitempfinden lassen. Ein Buch, dass den Impuls freisetzt, auch ganz viel von sich und seinem eigenen Lebensmosaik aus Erfahrungen und Erlebnissen und Empfindungen zu erzählen, selbst wenn man nicht betroffen ist.
Barbara erzählt darin von etlichen Therapien, von der Suche nach einem Trauma in ihrem Elternhaus, das es aber nicht gibt, von dem Moment, als sie mit ihrer besten Kindergartenfreundin und weiteren Kindern am Wasser spielte und ihre Freundin hineinrutschte, von der Trauer nach dem Tod ihrer Mutter – und von dem Unterschied zwischen Trauer und Depression –, von einem Klinikaufenthalt nach der Geburt ihres ersten Kindes. Ihre Offenheit, mit der sie von den Elementen ihres Lebens erzählt, setzt auch ganz viel Offenheit auf der LeserInnenseite frei und das ist eine Kunst. Ich bin dankbar für dieses Buch und wünsche ihm nicht nur viel Aufmerksamkeit, sondern auch sensible RezipientInnen.
Liebe Barbara, es gibt Phasen in deinem Leben, in denen du nicht aus dem Bett aufstehen kannst, weil die Depression dich lähmt, wie erklärt ihr euren Kindern, was bei Mama los ist dann?
Tatsächlich gab es so eine Phase schon lange nicht mehr. Meine letzte richtig schlimme Depression war 2011, da war meine Tochter ein Baby und mein Sohn noch nicht auf der Welt. Da waren also keine Erklärungen notwendig. Seitdem sehen sie mich natürlich jeden Tag Medikamente nehmen und fragen schon nach. „Mama, warum nimmst du Tabletten? Bist du krank?“ Dann sage ich: „Nein, ich bin nicht krank. Ich nehme die Tabletten, damit ich nicht krank werde.“
Vergangenes Jahr hatte ich dann zum ersten Mal seit langem wieder eine depressive Phase, die war aber nicht so heftig, dass meine Kinder viel bemerkt hätten, glaube ich. Ich war krankgeschrieben, lag viel im Bett mit Migräne. Aber alles, was an Kraft da war, hat meine Familie bekommen. Die steht inzwischen an erster Stelle. Und ich bin sehr schnell zu meiner Psychiaterin und meiner Psychotherapeutin gegangen, habe mir Unterstützung und mehr Medikamente geholt, so dass es keine besonders lange Phase war, glücklicherweise.
Habt ihr einen Notfallplan für den Fall, dass so eine Phase auch mal plötzlich kommt? HelferInnen, die einspringen können?
Besonders plötzlich kommen bei mir die depressiven Phasen nie. Es ist eher ein langsames Abrutschen, Monate, in denen ich mich frage: Ist das noch schlechte Laune oder schon eine depressive Phase? Aber ich habe ein sehr gutes Netzwerk, das brauche ich auch. Mein Mann und ich teilen uns die Familienarbeit hälftig auf, mein Vater und mein Bruder leben in der Nähe, meine Schwiegerfamilie unterstützt und ich habe großartige Freundinnen. Wäre es anders, hätte ich es nicht gewagt, Mutter zu werden.
Hast du das Gefühl, in den letzten Jahren hat sich im Umgang mit DepressionspatientInnen etwas geändert, gibt es da mehr Rückhalt, mehr Verständnis oder hast du das Gefühl, dass einige trotzdem noch denken: Nu stell dich mal nicht so an, wenn eben nichts mehr geht?
In meinem Leben gibt es solche Menschen nicht mehr. Depressionen sind ein guter Arschlochfilter. Wer mit dieser Krankheit nicht umgehen kann, mit dem bin ich schon mindestens zehn Jahre nicht mehr befreundet. Doch es gibt diese Leute bestimmt noch da draußen. Ob sich gesellschaftlich etwas getan hat, weiß ich nicht. Für mich persönlich hat sich sehr viel getan in den vergangenen zehn, 15 Jahren, mein Umgang mit der Krankheit ist viel offener geworden. Ich kann aber schwer auseinanderhalten, was davon mein persönlicher Weg war und was eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung.
Du hast deiner Tochter mal einen rührenden Brief geschrieben, um ihr zu erklären, was da mit ihrer Mama los ist, wenn ein Krankheitsschub kommt. Wie hat sie darauf reagiert?
Sie hat ihn nie gelesen. Er ist schließlich sehr lang, eher für Erwachsene geschrieben und meine Tochter keine besonders engagierte Leserin. Dieser „Brief an meine Tochter“ war eher eine schriftstellerische Kunstform als ein tatsächlicher Brief an ein siebenjähriges Kind. Aber sie weiß natürlich, dass es diesen Text gibt und auch ungefähr, was darin steht.
Es mag doof klingen, aber: Hat die Erkrankung auch gute Seiten? Indem sie dich durch die dunklen Täler, die sie mit sich bringt, die hellen Phasen vielleicht deutlich schöner erleben lässt?
Nein. Außer vielleicht, siehe oben, als Arschlochfilter. Auch in mir drin. Ich bin sehr ehrgeizig, verlange mir in gesunden Phasen einiges ab und früher fehlte mir das Verständnis für Menschen, die weniger Gas geben. Durch meine depressiven Phasen habe ich gelernt, mehr Mitgefühl zu haben, wenn mal jemand was nicht schafft – manchmal sogar mit mir selbst.
Depressionen treffen alle Bevölkerungsschichten. Bei vielen Betroffenen, die ich kenne, nehme ich eine sehr hohe Empfindsamkeit wahr. Ich stell mir das manchmal so vor, wie eine durchlässige Haut. Die ist zwar verletzlicher, weil schneller etwas in die Tiefe geraten kann, aber es perlt eben auch wenig von ihr ab… Bleiben wir mal bei dem Bild: Wo viel reingeht, kommt auch viel raus. Du bist Journalistin, in deiner Arbeit hast du immer auch vermeintlich Schwächere oder weniger gesehene Menschen mit im Auge. Ich finde das eine große Stärke. Die Frage ist: Kannst du das auch so sehen?
Doch, so sehe ich das auch. Ich erlebe es auch oft, dass Menschen ganz gerne mit mir reden, weil sie zum Beispiel den Text über Depressionen kennen. Dann entsteht so eine Vertrautheit, als würden sie denken: „Ich weiß etwas Persönliches über sie, jetzt kann ich ihr auch was Persönliches über mich erzählen.“
Seit wann hast du deine Diagnose und hat sie etwas verändert?
Zum ersten Mal stand eine psychiatrische Diagnose 2006 auf einem Arztbrief, der Arzt damals schrieb aber absichtlich von Anpassungsstörung, nicht von Depression. Es war zwar eine, aber er meinte, wenn er das jetzt hinschreibt, sind meine Chancen auf eine Berufsunfähigkeitsversicherung für immer hinüber. Lange ließ sich das aber nicht halten. Mir war die Diagnose viele Jahre lang unangenehm, ich habe sie verheimlicht und auf den Moment gewartet, wo ich das endlich nicht mehr habe.
In welchen Momenten weißt du, dass du Hilfe brauchst?
Meine rote Flagge sind inzwischen Suizidgedanken. Die sind nicht normal, zumindest nicht in einer gewissen Intensität. Wenn die also in meinem Kopf auftauchen, laufe ich sofort zu meiner Psychiaterin, diese Gedanken will ich da nicht haben. Aber natürlich ist das ein bisschen spät. Andere Warnzeichen sind, wenn mir nichts mehr Freude macht, was mir normalerweise Freude macht. Wenn ich jeden Tag um 21 Uhr ins Bett gehe, weil ich so froh bin, ihn überlebt zu haben. Und richtig schlimm wird es, wenn ich jeden Morgen um 4 Uhr wach werde und mir ein Elefant auf der Brust sitzt.
Was würdest du der frisch diagnostizierten Barbara und vielleicht auch andere Frauen in ähnlicher Situation gern mit auf den Weg geben?
Dass jede depressive Phase vorbei geht. Ich weiß weder wann noch wie, aber ich weiß, dass. Versprochen.


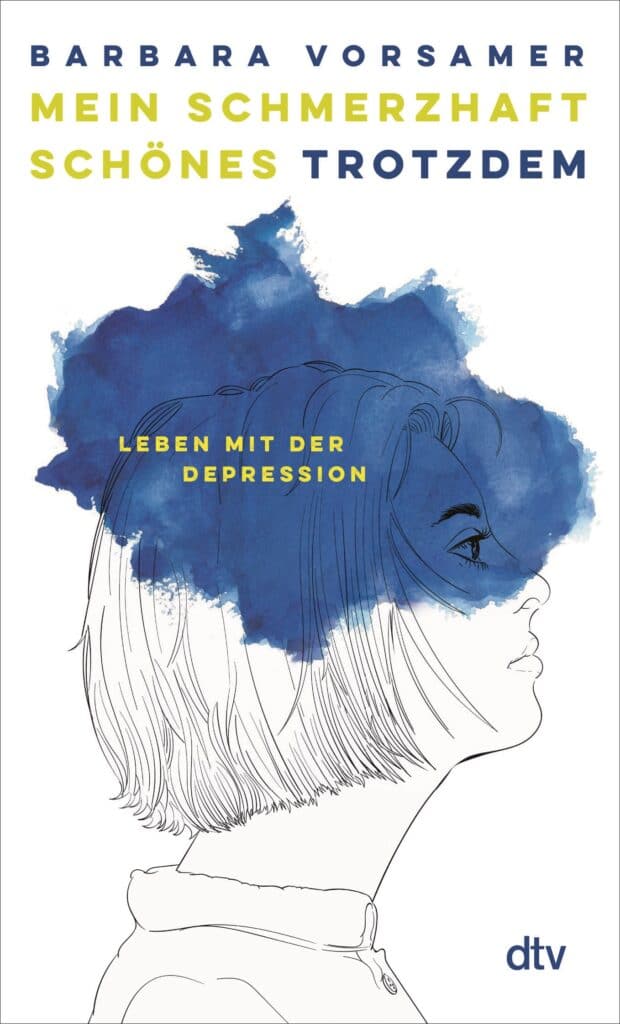

























1 comment
Ein tolles Interview und als selbst Betroffene, die die Diagnose vor 24 Jahren erstmals (da war ich 22) erhalten hat, hab ich mich sofort in vielen Antworten wiedergefunden. Ich habe auch ganz ganz lang gar nicht offen gegenüber anderen Menschen außerhalb der Familie und engsten Freundin diese Diagnose erwähnt, es wurde irgendwie immer umschrieben. Das hat sich vor über 5 Jahren, als ich die längste Phase mit Klinikaufenthalt hatte, radikal geändert. Und es ist tatsächlich so, obwohl man es in einer akuten Krise nicht für möglich hält, dass jede depressive Episode vorbeigeht…das Leben kann wieder Spaß und Freude bereiten, man kann wieder arbeiten gehen und ist belastbar. Diese Krankheit ist aber halt einfach nicht sichtbar wie z.B. Bein gebrochen oder noch schlimmer Krebs, jedoch ist es eine ebenso schwerwiegende Erkrankung (je nach Grad). Das Buch werde ich definitiv ganz schnell lesen! DANKE für den Tipp und das Interview.